Bei den Außenaufnahmen der
Waldzustandserhebung werden für jeden Probebaum äußerlich sichtbare
Schädigungen der Krone mit eindeutig erkennbarer Ursache gesondert
festgehalten. So werden Schäden durch blattfressende Insekten, Pilzbefall
von Blättern, Schäden durch Hagelschlag, Abbrüche starker Äste oder ganzer
Kronenteile und auch Beschädigungen des Stammes notiert. Seit 1993 wird auch
die Ursache für das Ausscheiden eines Probebaumes festgehalten. Damit ist es
möglich, Schädigungen durch Sturmwurf, Insekten- oder Pilzbefall auch bei
den aus dem Kollektiv ausgeschiedenen Probebäumen zu erfassen. Ausmaß und
Einfluss von Insekten- oder Pilzbefall oder Schäden durch Hagel, Schneebruch
oder Sturm werden im Vergleich zu den Befunden auf den
Dauerbeobachtungsflächen und unter Berücksichtigung der Meldungen der
Forstämter und der Untersuchungen zum Waldschutz bewertet.
Bei Eiche sind regelmäßig Schäden durch blattfressende Insekten zu
beobachten. Häufig handelt es sich dabei um Fraß durch Raupen von
Frostspannerarten und Eichenwickler. Die Eiche ist in der Lage durch einen
zweiten Austrieb Fraßschäden zu regenerieren. Oft ist diese Regeneration
aber nicht vollständig, so dass durch Fraßschäden ein Anstieg der
Kronenverlichtung ausgelöst wird. Häufig wird der Wiederaustrieb auch durch
den Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides oder Microsphaera
alphitoides) befallen. Insektenfraß und Mehltaubefall sind oft gemeinsam
an den Probebäumen zu finden.Der Frühjahrstrieb ist befressen, der zweite
Austrieb durch den Mehltaupilz befallen.
In 2020 waren an 10 % der
Eichen-Probebäume Fraßschäden beobachtet und notiert worden. Damit ist der
Anteil gegenüber dem Vorjahr (38 %) merklich niedriger, auch die
Fraßintensität ist nur gering.
Befall durch den Mehltaupilz wurde 2020 an 11 (1,6 %) der Probebäume (Vorjahr
8,5
%)
beobachtet.Insektenfraß und Mehltaubefall hat sich in
vielen Jahren als ein
bedeutsamer Einflussfaktor auf die Entwicklung des Kronenzustandes bei Eiche
erwiesen.
2020 wurden an einem Probebaum Ausbohrlöcher
des Eichenprachtkäfers (Agrilus biguttatus) festgestellt.
Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) wurde in den
wärmebegünstigten Wuchsgebieten Saar-Nahe-Bergland und Moseltal an fünf
Aufnahmepunkten beobachtet. Er verursacht meist nur unterschwellige
Fraßschäden und ist damit unbedeutend für die Kronenverlichtung. Wegen
seiner Brennhaare hat er aber eine hohe Bedeutung für die Aufnahmeteams. Bei
zu starker Präsenz kann an dem Aufnahmepunkt die Waldzustandserhebung wegen
der Gesundheitsgefährdung nicht durchgeführt werden.
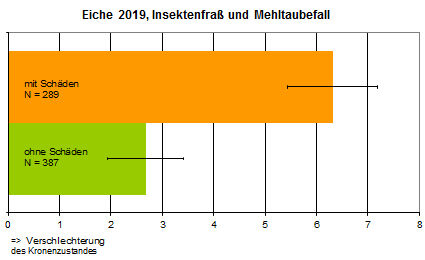
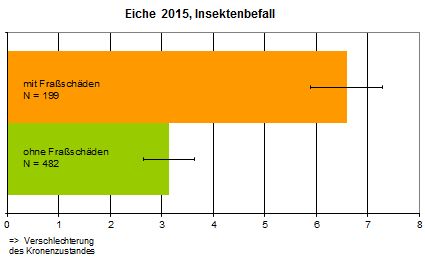
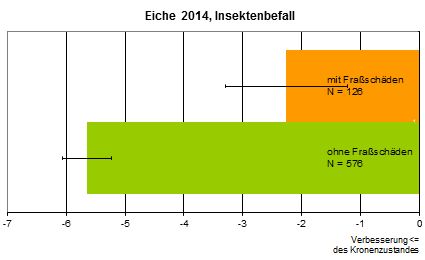


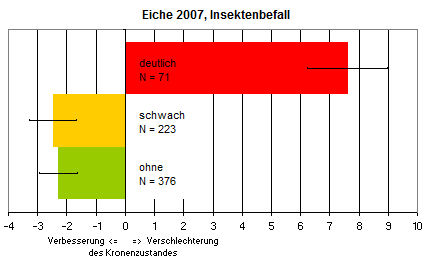

Veränderung der mittleren Kronenverlichtung in Prozentpunkten
nach der Intensität des Insektenbefalls bei Eiche in verschiedenen
Jahren
In 2019 ist die mittlere
Kronenverlichtung aller Eichen merklich angestiegen; dieser Schadanstieg
fiel bei den durch Fraß- und/oder Mehltauschäden betroffenen Eichen
deutlicher aus als bei denen ohne sichtbare Schädigungen.
Auch in 2015 ist die mittlere
Kronenverlichtung durchgehend angestiegen, auch hier war die Verschlechterung bei den von Fraßschäden betroffenen Eichen deutlicher.
In 2014 ist die mittlere
Kronenverlichtung der Eichen insgesamt zurückgegangen, die
Verbesserung der Eichen, an denen Insektenfraß beobachtet wurde, ist aber
weniger ausgeprägt.
In 2012 ist die mittlere
Kronenverlichtung der Eichen, bei denen Insektenfraß beobachtet wurde
umso stärker angestiegen, je stärker die Fraßschäden eingeschätzt waren. Die Eichen ohne erkennbare Fraßschäden und ohne erkennbaren
Pilzbefall wiesen dagegen einen leichten Rückgang der mittleren
Kronenverlichtung auf.
2011
war bei der Eiche trotz Insektenfraßes eine Verbesserung des Kronenzustandes
beobachtet worden. Nur die sehr deutlich von Fraßschäden betroffenen Eichen
wiesen einen Anstieg der Verlichtung auf.
In 2010 und 2008 ist
die mittlere Kronenverlichtung bei Eiche generell angestiegen. In beiden
Jahren zeigte sich, dass die stärker von Fraßschäden betroffenen Eichen
einen merklich höheren Anstieg der Kronenverlichtung aufweisen, als die
nicht oder nur geringfügig von Fraßschäden betroffenen.
In 2007 war an 44 % der
Probebäume Fraß, meist geringer Intensität, beobachtet worden, dennoch
konnten die Eichen in 2007 ihren Kronenzustand verbessern, nur bei den
stärker befressenen zeigte sich ein Anstieg der Kronenverlichtung.
In 2006
waren insgesamt an 64 % aller Probebäume Schäden durch Insektenfraß
festzustellen. Hier zeigte sich, dass nicht betroffene Eichen sich in ihrem
Kronenzustand verbesserten, stark befressene dagegen verschlechterten,
während bei den schwach befressenen keine Veränderung der Kronenverlichtung
zu beobachten war.
Der Regenerationsaustrieb der Eiche wird bevorzugt durch den Mehltaupilz befallen, sodass Fraßschäden und Pilzbefall nacheinander auftreten können und die befressenen Eichen zusätzlich geschwächt werden. Leichter Mehltaubefall ohne Blattdeformationen ist in den oberen Kronenteilen, auch mit Hilfe des Fernglases, nur schwer zu erkennen. Daher ist davon auszugehen, dass das Ausmaß des Befalles eher unterschätzt wird und nur stärkerer Mehltaubefall notiert wird. In 2019, 2012 und 2010 war Mehltau öfter beobachtet worden, die Auswertung zeigte, dass mehltaubefallene Eichen einen signifikant höheren Anstieg der mittleren Kronenverlichtung aufwiesen, als die nicht betroffenen.
Andere Schäden wie Mistelbefall oder Hagelschlag wurden 2020 nicht beobachtet. Frische Kronenbrüche traten bei den Eichen-Probebäumen nicht auf, aber Peitschschäden wurden vereinzelt beobachtet; beides wird als offensichtlicher mechanischer Schaden bei der Beurteilung des Kronenzustandes ausgeklammert. Stammschäden treten immer wieder auf und bleiben ein Leben lang sichtbar. So hat insgesamt rund ein Fünftel aller Probebäume einmal Stammschäden erlitten.
An etlichen Eichen sind in der Lichtkrone abgestorbene Zweige oder Äste zu sehen, ohne dass ein Grund für diese Absterbeerscheinungen erkennbar wäre. In 2019 war an rund 11 % der Probebäume dürres Reisig oder dürre Äste zu beobachten. Das Ausmaß wird am Einzelbaum abgeschätzt und bei der Beurteilung seines Blattverlustes mit berücksichtigt.

![]()
In 2020 sind bei der Eiche knapp 1,2 % der Probebäume ausgeschieden.
Im langjährigen Schnitt liegt die Ausscheiderate für Eiche bei
1,5 % und ist damit im Vergleich zum Gesamtkollektiv gering. Es zeigt
sich, dass die Eiche überwiegend durch geplante Holzernte aus dem
Probebaumkollektiv entnommen wird. Eine Ausnahme war in 2017, wurde an zwei
Aufnahmepunkten der Generationswechsel vollzogen, da der
Altbestand hier nicht mehr repräsentativ für den Waldort war. Die Altbäume
sind zwar noch vorhanden, wurden aber durch neu ausgewählte Probebäume aus
dem nachwachsenden Jungbestand ersetzt.